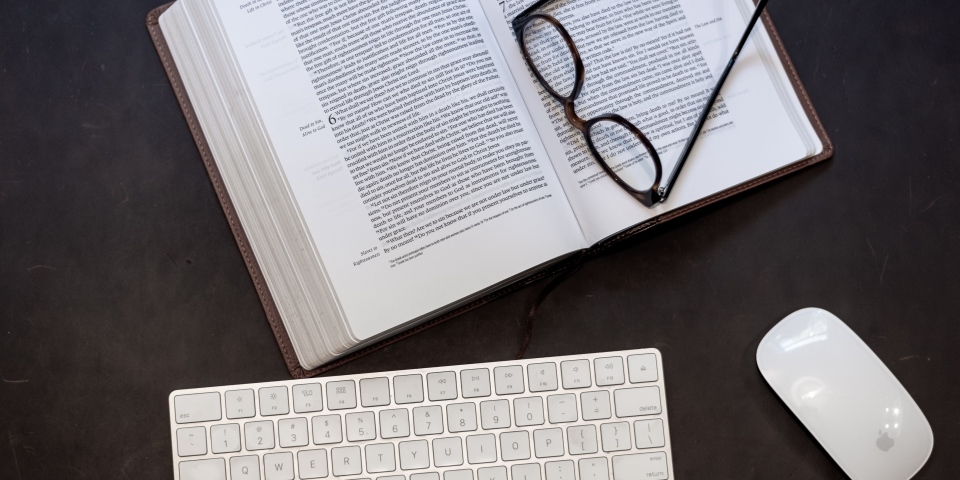Wie beeinflusst das Gehirn den Glauben?
Mit der neuen Forschungsrichtung «Neurotheologie» setzt sich die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in ihrem Materialdienst auseinander. Dabei untersuchen Hirnforscher den Zusammenhang zwischen Glaubenserfahrungen und Gehirnaktivitäten.
Seit längerem ist bekannt, dass bestimmte Hirnregionen beim Beten besonders aktiv sind. Laut dem wissenschaftlichen Referent der EZW, Michael Utsch, wird heute diskutiert, ob es neurobiologische Voraussetzungen für die Glaubensfähigkeit eines Menschen gebe. Die Wissenschaft gehe der Frage nach, ob sich Religion als Vorteil im Evolutionsprozess erwiesen habe oder ob Glaube eine «Fehlfunktion des Gehirns» darstelle.
Besondere Hirn-Aktivitäten?
Einige Wissenschaftler nähmen an, dass Glaubenserfahrungen von Moses, Jesus und Paulus auf besondere Aktivitäten ihres Gehirns zurückzuführen seien. So heisse es von Jesus, dass er bei seiner Taufe eine Lichterscheinung gehabt habe, und vom Apostel Paulus, dass ein epileptischer Anfall Ursache für sein Bekehrungserlebnisgewesen sei.
Weltanschauung prägt
Die Annahme, dass sich religiöse Erfahrungen allein durch Gehirnprozesse erklären liessen, weist Utsch zurück. Nach seinen Worten muss bei der Interpretation neuropsychologischer Befunde darauf geachtet werden, dass die Grenze zwischen naturwissenschaftlicher Analyse und einer auf weltanschaulichen Voraussetzungen beruhenden Deutung nicht verwischt werde.
Es sei unmöglich, mit wissenschaftlichen Methoden die Existenz Gottes zu beweisen oder zu widerlegen. Der Befund, dass eine regelmässige spirituelle Praxis die Emotionen und das Gehirn positiv beeinflusse, sollte nicht als Selbsterlösung verstanden werden, so Utsch. Auch müsse man berücksichtigen, «dass eine Alltagsgestaltung aus der Kraft des Glaubens mehr ist als ein meditativer Höhepunkt».
Begriff «Neurotheologie» falsch
Utsch zufolge führt der Begriff «Neurotheologie» in die Irre, weil es keine neurologische Begründung der Theologie gebe. Dennoch habe sich die Bezeichnung eingebürgert und werde selbst von Neurowissenschaftlern verwendet: «Präziser sollte allerdings von der Neuropsychologie der Religiosität gesprochen werden.» Diese Forschungsrichtung könne wertvolle Beiträge zu einem besseren Verständnis des religiösen Erlebens und Verhaltens liefern.
Datum: 30.05.2012
Quelle: idea.de