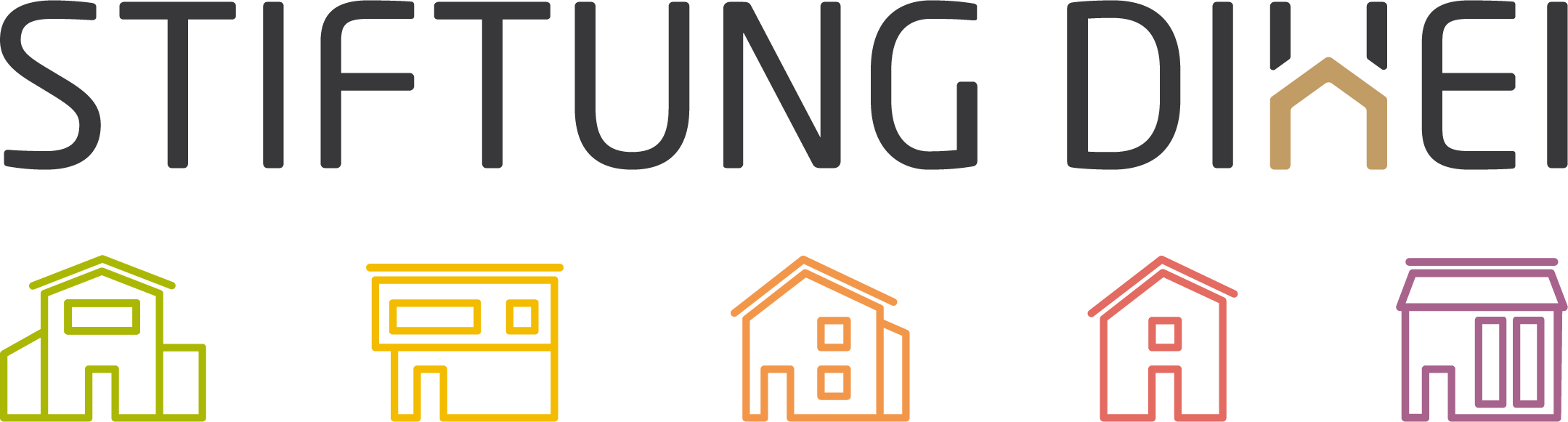Das Inselspital Bern ist ein riesiges Areal von Gebäuden, eine Stadt für sich mit Coiffeur, Post und Restaurants. Die Bewohnerinnen und Bewohner sehen sich aber ganz anderen Problemen ausgesetzt als diejenigen, die in der Nachbarschaft zur Arbeit gehen. Viele haben Angst, manchmal Todesangst. Die Seelsorger treten in den Riss zwischen innerer Not und krankem Körper. Mit den Menschen, die danach suchen, besprechen sie Fragen nach dem Warum und Woher. Hier gibt es keine einfachen Antworten und billige Trostsätze. Wer da ist, um für die Seelen von Patienten, Angehörigen oder Pflegeteam zu sorgen, muss sensibel und feinfühlig sein. „Gott muss zuerst gefunden werden im Leben dieser Menschen“, sagt Matthias Hügli. Er arbeitet vor allem im Departement für Krebskranke. „Sprüche und Überzeugungen nützen hier nichts – es müssen Erfahrungen sein.“ Er versucht zuerst herauszufinden, was die Menschen brauchen, zu denen er geschickt wird. Manchmal hört er eine halbe Stunde lang nur zu. Manchmal hilft es, wenn er einfach psychologische Ratschläge gibt. Manchmal kommt ihm ein Bibelvers in den Sinn. Aber er fragt immer zuerst nach, ob er eine Stelle aus der Bibel vorlese oder ob er mit seinem Gegenüber beten darf. Er versucht, Texte zu finden, mit denen sich der Patient oder die Patientin identifizieren kann. Dies ist für ihn eine Millimeterarbeit. Er muss ganz genau wahrnehmen können, wieviel Glauben jemand in der jeweiligen Situation ertragen kann. Wenn er zu weit geht, kann es sein, dass sein Gegenüber sich verschliesst. Spricht er den Glauben zu wenig an, verpasst er vielleicht die Chance, Trost zu vermitteln. Die Passionsgeschichte von Jesus macht vielen Menschen Eindruck: dass es neues Leben gibt, dass Gott in der schlimmsten Krise mittendrin war und dass etwas weitergeht. „Tod und Leben sind hier ganz nah miteinander verbunden – aber Gott ist die Kraft, die Leben will!“ „Es ist eine sehr harte Arbeit“, sagt Eleonore Näf, die vor allem mit chronisch kranken Menschen zu tun hat. Es erfordert viel Kraft, in auswegslosen Situationen und in der Trauer von Angehörigen und Patienten der Fels in der Brandung zu sein, der Trost und Halt vermitteln kann. Die Pikett-Einsätze – oft am Wochenende, manchmal abends und in der Nacht – sind zumeist die härtesten. Angehörige, die einen Partner verloren, oder Patienten, die einen schweren Unfall erlitten haben, möchten betreut werden. Sehr oft sind Seelsorgende dann mit Schock, Verzweiflung, aber auch Fragen rund um Therapieabbruch oder Organspende konfrontiert. Vor einem Gespräch kann man nie wissen, was einen erwartet. Eleonore Näf hat es sich deshalb zur Angewohnheit gemacht, vorher kurz im Gang zu beten. „Ich mache so die Erfahrung, dass ich Verantwortung abgeben kann, die ich nicht tragen muss“, sagt sie. „Ich muss nicht alles lösen können – ich kann auf Gott vertrauen.“ Das Team von neun Spitalseelsorgerinnen und -seelsorgern trifft sich jeden Morgen zu einer Textlese und Fürbitte für Patienten und Angehörige, die dies wünschen. Jeden Sonntag findet in der reformierten und der katholischen Kapelle auf dem Inselgelände ein Gottesdienst statt. Sie erlebe viel Dankbarkeit für ihre Arbeit, sagt Eleonore Näf. Das gebe ihr die Sicherheit, dass sie als Team ihren Auftrag richtig erfüllen. „Durch das, was ich tue, soll etwas von dem Gott spürbar werden, der in Jesus Christus den Menschen nahe gekommen ist und der versprochen hat, uns Menschen in schwierigen Zeiten nahe zu sein. Wenn das möglich ist, macht mich das glücklich“, beschreibt Eleonore Näf ihre Motivation. Matthias Hügli formuliert es ähnlich: „Mein Wunsch ist es, dass Menschen Gott finden – dass sie merken, wie sie gehalten sind.“
Sie kommen sofort, wenn sie gerufen werden, führen Gespräche und beten, wenn das erwünscht ist. Über Feinfühligkeit, Trost und Millimeterarbeit erzählen zwei Seelsorger vom Inselspital Bern.
Behutsamkeit in Fragen des Glaubens
Einsätze zwischen Leben und Tod
Halt und Liebe vermitteln
Datum: 21.10.2005
Quelle: Livenet.ch