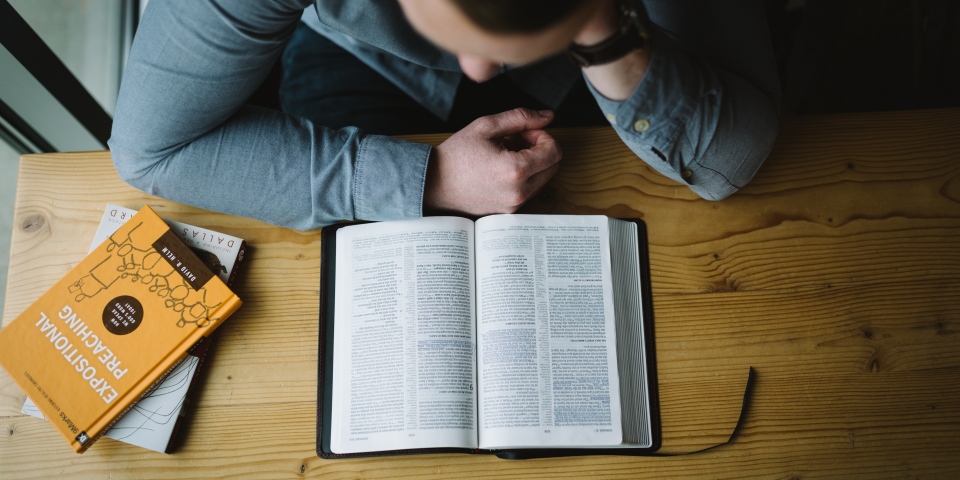Ein Sohn sein heisst: in seiner Art von jemand oder etwas bestimmt sein
Der Sinn des Wortes Sohn im Neuen Testament kann nur erfasst werden im Zusammenhang mit den Lebensverhältnissen und Anschauungen des alten Orients. Der Orientale hat einen besonderen Sinn für die bluthafte Zusammengehörigkeit von Vater und Sohn und für deren tiefgehende geheimnisvolle Wirkungen.Was uns nach langem, mühevollem Forschen langsam zu dämmern beginnt, die Bedeutung der Vererbung - das hat der Morgenländer schon längst mit sicherem Instinkt erfasst und viel klarer gesehen. Ein Sohn ist dem Orientalen immer einer, der in seiner Art, im Kern seines Wesens bestimmt oder geformt ist durch den, von dem er herkommt.
Ein Sohn sein heisst: ähnlich sein, die Züge seines Vaters an sich tragen. Im übertragenen Sinne bedeutet dann Sohn: einer, der das Gepräge von jemand oder etwas trägt, der in seiner Art von einer Person oder Sache bestimmt ist. Zum Beispiel
- »Söhne des Bräutigams« (Matth. 9,15. Luther: Hochzeitsleute) sind Menschen, deren Grundzug Freude, eine festlich erhöhte Stimmung ist;
- Söhne (Kinder) des Teufels (1. Joh. 3,10, vgl. Joh. 8,44) sind Menschen, deren Art und Lebensrichtung satanisch ist;
- Söhne dieses Zeitalters (Luk. 20,34) sind Menschen, deren Lebenshaltung durch diese Weltzustände bestimmt ist.
- Söhne der Auferstehung werden die Menschen einmal sein, das heisst, ihr Leben wird in allem das Gepräge der mit der Auferstehung kommenden Vollendung tragen (Luk. 20,36).
Der Sohn ist dem Vater lebensverbunden
Bei dem ausgesprochenen Sinn, den der Orientale hatte für den artmässigen Zusammenhang von Vater und Sohn, kam es dann von selbst, dass Vater und Sohn einander im Leben ausserordentlich nah verbunden waren und stets zusammenhielten (dies »ausserordentlich« ist gesagt im Vergleich zu uns Abendländern).Bei uns im Westen gilt es als das normale, dass der erwachsene Sohn sich vom Vater unabhängig macht, sein Leben für sich lebt. Man hält sich nicht weiter darüber auf, wenn der Sohn etwa auch weltanschaulich in schroffen Gegensatz zu seinem Vater tritt. Im alten Orient war es das Normale, dass auch der erwachsene Sohn seinem Vater verbunden blieb. »Der Sohn bleibt im Haus« (Joh. 8,35); das ist sein Vorrecht vor dem Sklaven, der weggegeben, verkauft, vertauscht werden kann.
Johannes 5,17-27 schildert Jesus das Sohn-und-Vater-Verhältnis. Er nimmt die Farben dazu aus dem damaligen Leben. Dem Sohn ist es das Natürlichste von der Welt, dass er mit dem Vater zusammen wirkt und sich dabei von ihm leiten lässt. Als Sohn hängt er so am Vater, dass er aus einem inneren Muss nur tun kann, was er den Vater tun sieht.
Der Vater seinerseits steht ganz zum Sohn. Er unterrichtet ihn über sein Werk, weiht ihn ein in seine Pläne und bevollmächtigt ihn, an seiner Stelle zu handeln. Wo der Sohn im Auftrag des Vaters hinkommt, hat er Anspruch auf dieselben Ehren wie der Vater.
Das ganze, dem damaligen Menschen vor Augen stehende Bild von der tiefen Artverbundenheit zwischen Vater und Sohn steht im Hintergrund dessen, was das Neue Testament vom Sohn und von den Söhnen sagt.
Die Anrede »Unser Vater«
Jesus lehrt uns beten: Unser Vater. Das ist von ihm nicht als tröstliche Formel gemeint. Er erinnert uns dadurch an unsere Herkunft, an unsere wesentliche, tiefursprüngliche Zugehörigkeit zu Gott, an unser angestammtes Recht, ihm zu nahen und ihn um alles zu bitten.Mit so mächtigen Banden ist der Mensch seinem Schöpfer verbunden, dass auch lange Zeiten der Trennung und Entfremdung ihn nicht für immer von ihm lösen können: Einmal kehrt er doch zurück wie jener davongegangene Sohn.
Die Grundlage der Forderung der Bergpredigt
Die unerhörten Forderungen Jesu in der Bergpredigt haben zu ihrer Grundlage die angestammte göttliche Art des Menschen. Es kommt den Jüngern zu, so göttlich unabhängig dazustehn, mitten im Getobe des Hasses und der Leidenschaften eine unerschütterliche Ruhe zu bewahren und auf das ihnen zugefügte Böse mit ungetrübter Freundlichkeit zu antworten, auf dass sie sich erweisen als Söhne des Vaters in den Himmeln (Matth. 5,45), das heisst als mit dem Vater im Himmel artgleich.Durch den Geist von oben wird die Sohnesart und Sohnesstellung des Menschen wiederhergestellt
Ein menschlicher Vater kann nicht anders als seinem eigenen Fleisch und Blut das Notwendigste geben. So kann der Schöpfer nicht anders, er muss denen, die aus dem Schoss seiner Gottheit hervorgingen, seinen Geist geben, das heisst seine Art, Kraft und Lebensfülle in ihnen erneuern (Luk. 11,13), wenn sie ihn darum bitten.Hat dann ein Mensch seine Lebensantriebe aus dem Geist Gottes, so ist er in Wahrheit ein Sohn des himmlischen Vaters, ein ihm ähnliches Wesen (Röm. 8,14). Durch den Geist schlägt die göttliche Art des Menschen wieder durch und kommt es wieder zur normalen Verbindung zwischen Mensch und Gott.
»Der Sohn bleibt im Haus«, das besagt, der Mensch bleibt jetzt in der Nähe seines Gottes. Wie ein Sohn sich zu Hause mit Sicherheit bewegt, weil er sich überall auskennt, so kann der gottnahe Mensch sich in allen Lebenslagen göttlich zurechtfinden und ohne Furcht oder Zweifel handeln.
- Er kann gar nicht mehr anders als mitwirken, wo Gott wirkt.
- Er ist eingeweiht in das Tun seines Vaters und kann sich jederzeit, wenn es not tut, von neuem Klarheit und Kraft holen.
- Er ruft dann mit der Selbstverständlichkeit des Kindes, das noch keinen Argwohn kennt: »Vater, gib sie mir!«
»Abba« nannten die ganz kleinen aramäisch sprechenden Kinder ihren Vater. Eine alte Legende sagt, dass Jesus als kleiner Knabe beim Beten so gerufen habe. Die Söhne - die gottnahen Menschen - bitten ebenso freudig wie der Sohn, Christus (Gal. 4,6.7)
Datum: 09.12.2009
Autor: Ralf Luther
Quelle: Neutestamentliches Wörterbuch