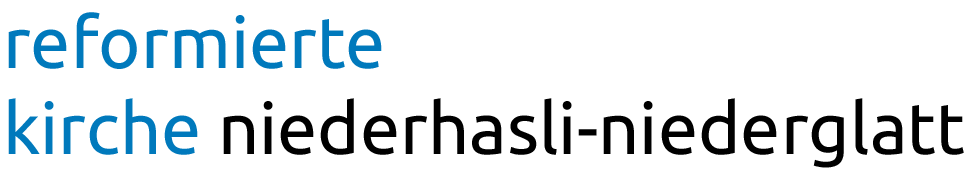"Die Embryonenforschung läuft Gesetzgeber und Ethik davon", fasste René Pahud de Mortanges, Direktor des Freiburger Instituts für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht, das zur Veranstaltung eingeladen hatte, die Diskussionsbeiträge des Tages zusammen, die das Thema von rechtlicher, theologischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher Seite beleuchtet hatten. Anlass der Tagung habe das Gesetzgebungsverfahren gegeben, das derzeit für das geplante Bundesgesetz über die Forschung an überzähligen Embryonen und embryonalen Stammzellen durchgeführt werde. Das Recht habe den Embryo in der Vergangenheit immer geschützt und nicht zugelassen, dass er als blosser Zellklumpen behandelt werde, den man einem Fremdnutzen zuführen könnte, betonte Rainer J. Schweizer, Professor für öffentliches Recht an der Universität St. Gallen. Auch Leben und Gesundheit des Embryos seien nach Bundesverfassung und nach Völkerrecht grundsätzlich geschützt. Die Embryonenforschung stelle in dieser Hinsicht eine Art "juristischer Wasserscheide" dar. Denn es wäre neu, wenn Eingriffe an einem Embryo zum Nutzen von Dritten zugelassen würden. Die Bundesverfassung enthalte zwar stillschweigend einen Gesetzesvorbehalt für eine Regelung der Fragen der Empfängnisverhütung und des Schwangerschaftsabbruchs, räumte Schweizer ein. Doch könnten die gesellschaftlich sehr kontrovers beurteilten Fragen der Grundrechtskollision zwischen der persönlichen Freiheit der Mutter und den Schutzpflichten gegenüber dem Embryo mit Blick auf die ausschlaggebende Funktion und Rolle der Mutter für die Entwicklung des Embryos und Fötus "keineswegs absolut und undifferenziert gelöst werden". Schweizer erinnerte daran, dass Artikel 119 der Schweizer Bundesverfassung die Forschungsfreiheit deutlich beschränkt. So sei die Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken verfassungsrechtlich unzulässig und entsprechend auch die Aufzucht im Ausland und Import rechtswidrig. Er machte darauf aufmerksam, dass viele Forscher mit diesen Einschränkungen Mühe hätten und zitierte einen, der mit Blick auf die verbrauchende Embryonenforschung schlicht gesagt habe: "Die Wissenschaft muss das tun können." Eine Bestimmung in Artikel 119 heisst: "Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen sind unzulässig." Schweizer bekannte indes, seine Auslegung, dass dieses verfassungsrechtliche Klonverbot auch für die Forschung zutreffe, sei umstritten, weil dem die Forschungsfreiheit entgegenstehe. Dietmar Mieth, Professor für theologische Ethik in Tübingen, verwies darauf, dass die "assistierte Fortpflanzung" im Reagenzglas, die als solche bereits fragwürdig sei, als Türöffner für die verbrauchende Embryonenforschung gewirkt habe. So sieht etwa der Entwurf für das geplante Schweizer Bundesgesetz vor, dass die bei der "In-vitro-Fertilisation" entstehenden "überzähligen" Embryonen zu Forschungszwecken "verbraucht" werden dürfen. Miet warnte zudem davor, die Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens nach den Entwicklungsetappen des Menschen abzustufen. Die Menschenwürde sei in allen Stadien zwischen dem Anfang des Menschenlebens (Befruchtung) und dessen Ende (Erlöschen der körperlichen Funktionen) gleich vorhanden. Die Würde des Menschen dürfe man nicht an bestimmte Eigenschaften des Menschen binden. Die Menschenwürde sei gegeben, "weil der Mensch ein Mensch ist"."Juristische Wasserscheide"
Import von Embryonen rechtswidrig
Assistierte Fortpflanzung als Türöffner
Datum: 28.10.2002
Quelle: Kipa