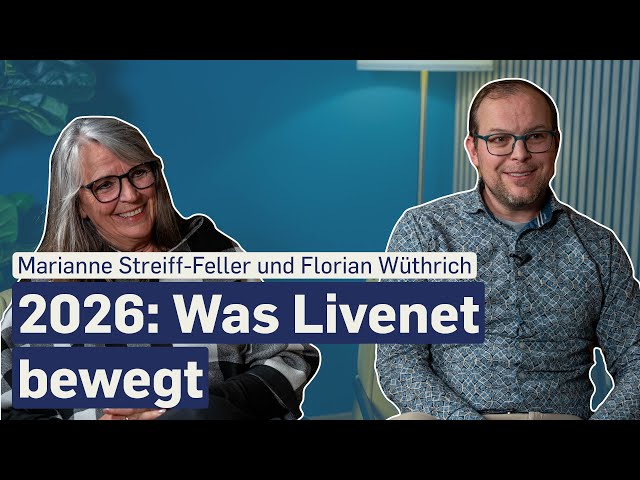Philipper
– schrieb den Philippern über die Freude und die Kraft, die er in Christus gefunden hatte (1,1 – 4,23)
Timotheus – ein Missionar mit jüdischen und heidnischen Vorfahren, von Paulus zugerüstet, um seinen Dienst in Philippi zu erfüllen (1,1 – 2,23)
Epaphroditus – treuer philippischer Arbeiter; er wurde mit einer Geldgabe zu Paulus geschickt (2,25-30; 4,18)
Evodia – treue Arbeiterin, die von Paulus zurechtgewiesen wurde, weil sie sich mit ihrer Schwester Syntyche nicht versöhnen wollte (4,2.3)
Syntyche - treue Arbeiterin, die von Paulus zurechtgewiesen wurde, weil sie sich mit ihrer Schwester Euodia nicht versöhnen wollte (4,2.3)
Hintergrund und Umfeld
Philippi hiess ursprünglich Krenides (»die kleinen Quellen«), weil sich in der Nähe zahlreiche Quellen befanden. Den Namen Philippi (»Stadt des Philippus«) erhielt sie von Philippus II. von Mazedonien, dem Vater Alexanders des Grossen. Angezogen von den nahe gelegenen Goldminen eroberte Philippus diese Region im 4. Jh. v. Chr. Im 2. Jh. v. Chr. wurde Philippi der römischen Provinz Mazedonien angegliedert.
Die nächsten zwei Jahrhunderte verblieb die Stadt relativ im Verborgenen, bis eines der bekanntesten Ereignisse der römischen Antike dafür sorgte, dass diese Stadt Bekanntheit und Wachstum erlangte. Im Jahre 42 v. Chr. schlugen die Streitmächte von Antonius und Kleopatra die Truppen des Brutus und Cassius in der Schlacht von Philippi. Damit endete die Römische Republik und es begann das Römische Reich. Nach der Schlacht wurde Philippi römische Kolonie (vgl. Apg 16,12) und viele Veteranen der römischen Armee liessen sich hier nieder.
Als Kolonie genoss Philippi Autonomie von der Provinzregierung und dieselben Rechte wie die Städte in Italien, einschliesslich des Gebrauchs des römischen Rechts (abgesehen von einigen Steuern) und der römischen Staatsbürgerschaft für ihre Einwohner (Apg 16,21). Die Philipper waren sehr stolz darauf, dass ihre Stadt eine Kolonie war, und daher wählten sie Latein als ihre offizielle Sprache, übernahmen römische Bräuche und richteten ihre Stadtverwaltung nach dem Muster der italienischen Städte aus.
Die Gemeinde in Philippi war die erste, die Paulus in Europa gründete. Sie geht zurück auf Paulus’ zweite Missionsreise (Apg 16,12-40). Zu den ersten Bekehrten zählten Lydia, eine wohlhabende Händlerin, die teure purpurfarbene Waren verkaufte (Apg 16,14) und der Gefängniswärter, in dessen Haus Paulus und Silas gefangen gehalten wurden, bis sie durch ein Erdbeben befreit wurden. Er war einer der ersten, der sein Herz dem Evangelium öffnete. Die Apostelgeschichte und der Philipperbrief beschreiben beide Philippis Status als römische Kolonie. Dass Paulus die Christen als Himmelsbürger bezeichnete (3,20), war angebracht, denn die Philipper rühmten sich ihres römischen Bürgerrechts (vgl. Apg 16,21). Es ist gut möglich, dass einige der pensionierten Veteranen in Philippi früher zu der Prätorianer-Garde zählten (1,13) und am Hof des Kaisers (4,22) dienten.
Schlüssellehren im Philipperbrief
Christi Demut – Christus kam in die Welt, um zu dienen und sich für die Menschheit zu opfern (2,5-8; Ps 22,7; 69,10; Jes 50,6; 53,3.7; Sach 9,9; Mt 11,29; 13,55; Lk 2,4-7.51; 9,58; Joh 5,41; 13,14.15; Röm 15,3; 2Kor 8,9; Hebr 2,16; 4,15; 5,7)
Unterodnung unter Christus – die Christen sollten danach streben, Christus ähnlicher zu werden (1,21; 3,7-14; 1Mo 43,14; Ri 10,15; 1Sam 3,18; 2Sam 15,26; Hi 2,10; Ps 37,7; 46,11; Mt 6,10; Apg 7,59; Hebr 12,6; 2Pt 1,14)
Christi Fürsorge für die Gläubigen – Gott sorgt für seine Kinder (4,13.19; Neh 9,19; Ps 146,7-9; Mt 9,36; Joh 7,37; 2 Kor 9,12; 12,9.10; Hebr 4,16)
Gottes Wesen im Philipperbrief
Gott ist herrlich – 2,11
Gott ist barmherzig – 2,27
Gott ist vorhersehend – 1,12
Christus im Philipperbrief
Im Philipperbrief finden wir eines der ergreifensten Zeugnisse eines Christenlebens.
Paulus beschreibt seine Beziehung zu Christus mit den Worten: »Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn« (1,21). Sein selbstloser Wandel weckt in ihm nicht den Eindruck von Verlust, sondern lässt ihn die Freude und den Frieden Jesu erfahren (4,4-7). Deshalb ermutigt er die Christen, auch danach zu streben, Christus immer ähnlicher zu werden (2,5).
Schlüsselworte im Philipperbrief
Fürsorge/Vorsorge: Griechisch epichoregia – 1,19 – beschreibt einen Chorleiter, der während einer Tournee für die Bedürfnisse der Sänger sorgt; d.h. er kümmert sich um ihren Lebensunterhalt. Mit der Zeit wurde das Wort ein Synonym für »vollkommen für den Lebensunterhalt aufkommen«. Durch ihre Gebete bewegten die Philipper den Heiligen Geist also zur »Fürsorge«. Paulus freute sich auf die volle Unterstützung durch den Heiligen Geist als ein Resultat der Gebete der Philipper.
Gestalt Gottes: Griechisch morphe theou – 2,6 – das Wort morph bedeutet »Form/Gestalt« und beschreibt die Existenz und das Erscheinungsbild einer Sache in Beziehung zu seiner inneren Beschaffenheit und Natur. Folglich versteht man unter der Wendung »Gestalt Gottes« wahrscheinlich am besten einen Ausdruck, der Gottes Eigenschaften und sein innerstes Wesen widerspiegelt. Wenn es also heisst, dass Christus in der Gestalt Gottes war, bedeutet das, dass er abgesehen von seiner menschlichen Natur alle Eigenschaften und Vorzüge Gottes besass, denn er ist ja tatsächlich Gott.
Tugend: Griechisch arete – 4,8 – ein seltenes Wort im NT. In der griechischen Literatur beschreibt es generell eine hohe Form moralischer Exzellenz. Petrus benutzte dieses Wort in seinem ersten Brief, um die vorzüglichen Wesensmerkmale Gottes zu beschreiben (1. Pt 2,9). Von verschiedenen Leuten wird berichtet, dass sie einen vorzüglichen Charakter hätten, es handelt sich dabei jedoch um ein Wesensmerkmal, dessen Ursprung in Gott liegt. Ein tugendhafter Wandel in moralischer Vorzüglichkeit bleibt aber denen vorbehalten, die Gottes Kraft in ihrem Leben erfahren haben und ihr Raum zum Wirken geben.
Gliederung
Paulus’ Grüsse (1,1-11)
Paulus’ Situation (1,12-26)
Paulus’ Ermahnungen (1,27 – 2,18)
- In Verfolgungen standhaft zu sein (1,27-30)
- Durch Demut einmütig zu sein (2,1-4)
- An das Vorbild Christi zu denken (2,5-11)
- Ein Licht in einer finsteren Welt zu sein (2,12-18)Paulus’ Begleiter (2,19-30)
- Timotheus (2,19-24)
- Epaphroditus (2,25-30)Paulus’ Warnungen (3,1 – 4,1)
- Vor Gesetzlichkeit (3,1-16)
- Vor Gesetzlosigkeit (3,17 – 4,1)
Paulus’ Appelle (4,2-9)
Paulus’ Dankbarkeit (4,10-20)
Paulus’ Abschied (4,21-23)
Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort auf der Erde …
Buddhistische Mönche ziehen von Indien nach China. Die von ihnen eingeführten Sprechgesänge werden später ein fester Bestandteil chinesischer Musik.
Häufig auftauchende Fragen
1. Was können wir anhand der Lobesrede (2,6-11) über Jesus lernen?
Das ist der klassische christologische Abschnitt des NTs über die Fleischwerdung, das Wesen und die Göttlichkeit Jesu. In der Urgemeinde wurde er wahrscheinlich als geistliches Lied gesungen.
Paulus bekräftig als erstes, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war (2,6). Er verwendet hier nicht das übliche gr. Wort für »sein«. Stattdessen wählte Paulus einen anderen Begriff, der das innere Wesen einer Person und ihren dauerhaften Zustand betont. Paulus konnte auch zwischen zwei gr. Wörtern für »Gestalt« wählen, aber er entschied sich für das Wort, das insbesondere den inneren, unveränderlichen Charakter einer Sache oder Person beschreibt, d.h. das, was sie in sich selbst ist. Diese entscheidenden Eigenschaften haben stets zur grundlegenden Lehre der Gottheit Christi gehört (vgl. Joh 1,1.3.4.14; 8,58; Kol 1,15-17; Hebr 1,3). Obwohl Christus alle Rechte, Privilegien und Ehren Gottes hatte – derer er würdig war und die ihm niemals abgesprochen werden könnten –, war es seine Gesinnung, nicht an diesen göttlichen Vorrechten oder seiner Stellung zu hängen. Vielmehr war er bereit, sie für eine Zeit lang aufzugeben.
Der nächste Abschnitt beschreibt die Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten, damit Christi Fleischwerdung Realität wurde. Zuerst »machte er sich zu nichts« oder besser gesagt »er entäusserte sich selbst« (2,7). Von diesem gr. Wort stammt der theologische Begriff »Kenosis«, d.h. die Lehre von Jesu Selbst-Entleerung in seiner Fleischwerdung. Damit trennte er sich weder von seiner Gottheit noch tauschte er seine Gottheit gegen eine Menschennatur aus, sondern dieser Begriff beschreibt seine Selbstentsagung, d.h. Jesus legte in bestimmten Bereichen seine Privilegien ab bzw. verzichtete darauf:
- Seine himmlische Herrlichkeit (Joh 17,5)
- Unabhängige Autorität – während seiner Fleischwerdung unterwarf Christus sich völlig dem Willen seines Vaters (Mt 26,39; Joh 5,30; Hebr 5,8)
- Göttliche Vorrechte – er legte die freiwillige Darstellung seiner göttlichen Eigenschaften ab und unterwarf sich der Führung des Heiligen Geistes (vgl. Mt 24,36; Joh 1,45-49)
- Ewige Reichtümer – (vgl. 2Kor 8,9)
- Eine wohlwollende Beziehung Gottes zu ihm – am Kreuz bekam er den Zorn Gottes wegen der Sünde der Menschen zu spüren (vgl. Mt 27,46; s. Anm. zu 2Kor 5,21).
Als nächstes wird uns gezeigt wie Jesus »Knechtsgestalt annahm und wie ein Mensch erfunden wurde«. Wiederum benutzt Paulus das gr. Wort »Gestalt«, das das eigentliche Wesen bezeichnet. Christus wurde mehr als »nur« Gott in einem menschlichen Körper, sondern er nahm die wesensmässig menschlichen Eigen schaften an (Lk 2,52; Gal 4,4; Kol 1,22), und das sogar so weit, dass er sich mit den Grundbedürfnissen und Schwachheiten der Menschen identifizierte (vgl. Hebr 2,14.17; 4,15).
Nach all dem widmete sich Christus dem eigentlichen Zweck seiner Mission und erfüllte den ihm von Gott übertragenen Auftrag. Als Mensch machte er alle Erfahrungen, die das Leben eben mit sich bringt, durch. Seine Demütigung ging bis ans Äusserste und er starb als Verbrecher am Kreuz, womit er Gottes Plan für sich befolgte (vgl. Mt 26,39; Apg 2,23).
Christi Erniedrigung (2,5-8) und Erhöhung durch Gott (2,9-11) sind ursächlich und untrennbar miteinander verbunden. Christi Erhöhung umfasst mindestens sechs Aspekte:
- Seine Auferstehung
- Seine Krönung (seine Stellung zur Rechten Gottes)
- Seine Rolle als Fürsprecher der Gläubigen (Apg 2,32.33; 5,30.31; vgl. Eph 1,20.21; Hebr 4,15; 7,25.26).
- Seine Hinaufsteigen in den Himmel (Hebr 4,14)
- Sein beglaubigtes und vollkommenes Sühneopfer für die Sünde
- Sein Titel und Name »HERR«, die ihn als göttlichen und souveränen Herrscher bestätigen (Jes 45,21-23; Mk 15,2; Lk 2,11; Joh 13,13; 18,37; 20,28; Apg 2,36; 10,36; Röm 14,9-11; 1Kor 8,6; 15,57; Offb 17,14; 19,16).
Die Bibel bekräftigt Jesu recht mässigen Anspruch auf den Titel »Gott-Mensch« wiederholte Male.
2. An wen denkt Paulus, wenn er von »den Feinden des Kreuzes« spricht?
Offenbar hatte Paulus die Philipper – ebenso wie all die anderen Gemeinden (Apg 20,28-30) – vielfach vor der Gefährdung durch Irrlehrer gewarnt. Paulus’ Ausdrucksweise zeigt deutlich, dass diese Männer nicht behaupteten, sie hätten etwas gegen Christus, sein Werk am Kreuz oder die Errettung allein aus Gnade durch Glauben. Aber ihr Leben sprach eine andere Sprache, es war nichts als Betrug und Schwindel. Sie strebten nämlich nicht nach Christusähnlichkeit in Form von offenkundiger Gottseligkeit und hatten möglicherweise sogar schon Führungspositionen in der Gemeinde erreicht. Ihr Wandel machte deutlich, mit wem sie tatsächlich im Bund standen.
3. Inwiefern verdeutlichen die beiden Worte »Freude« und »sich freuen« Paulus’ Hauptbotschaft an die Gläubigen in Philippi?
Das Wort »Freude« kommt im Philipperbrief vier Mal (1,4.25; 2,2; 4,1) und »sich freuen« neun Mal (1,18 zwei Mal; 1,26; 2,17.18; 3,1; 4,4 zwei Mal; 4,10) vor. In den ersten Kapiteln nimmt Paulus hauptsächlich Bezug auf die Freude, die er in seinem persönlichen Leben als Christ erfahren hatte. Ab Kapitel 3 geht es dann aber eher um allgemeingültige geistliche Wahrheiten. Hier fügt Paulus jedoch zum ersten Mal »im Herrn« (3,1) hinzu und nennt damit den Bereich, in dem die Freude des Gläubigen besteht. Dieser Bereich ist unabhängig von den Lebensumständen, aber abhängig von einer unangreifbaren, unabänderlichen Beziehung zum höchsten Herrn.
Das Thema der Freude erreicht mit Philipper 4,4 seinen Höhepunkt »Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch«! Die folgenden Verse führen uns die Merkmale eines Menschen, dessen Freude echt ist, vor Augen. Sie verdeutlichen die innere Einstellung und das äussere Verhalten eines freudigen Christen. Paulus schliesst auch Gottes Verheissung ein, die dem Christen, dessen Freude in Christus Jesus verborgen liegt, seine Gegenwart und seinen Frieden zusichert.
Kurzstudium zum Philipperbrief/einige Fragen
- Lies Philipper 2,5-11 und formuliere anschliessend mit deinen eigenen Worten, wie Christi Wandel dein persönliches Leben beeinflusst!
- Im Philipper 3 vergleicht Paulus seine eigenen Errungenschaften mit der Erkenntnis Christi. Welchen Schluss zieht er?
- Paulus betont in seinem Brief immer wieder den Aspekt der Freude. Wie macht er das? Welche unterschiedlichen Aspekte zeigt er auf?
- Welche Richtlinien setzt Paulus in Kapitel 4 bezüglich deines Gebets- und Gedankenlebens? Hältst du dich daran?
- Was meint Paulus, wenn er sagt »Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus« (4,13)? Teilst du Paulus’ Erfahrung hinsichtlich dieser Entdeckung? Wenn ja, inwiefern?
Datum: 29.05.2007
Autor: John MacArthur
Quelle: Basisinformationen zur Bibel