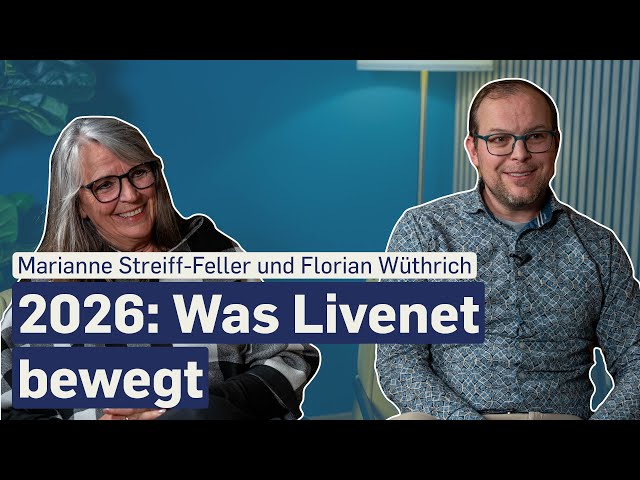Derzeit werden in der Schweiz vier von zehn Ehen geschieden, und bald dürfte jede zweite Ehe so enden. Die Zahl der Eheschliessungen nimmt seit Jahren stetig ab, die Zahl der Scheidungen dagegen wächst ebenso stetig. Besonders schädlich für die Ehe sei die "Überidealisierung von Beziehungen", meint der St. Galler Eheberater Niklaus Knecht. Die Ehe ist eine Institution in der Krise. Verschärft wird diese Krise nach Ansicht der Schweizer Bischöfe mit dem Partnerschaftsgesetz, das gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, ihre Lebensgemeinschaften rechtlich abzusichern - falls am 5. Juni das Volk an der Urne zustimmt. Das Modell der registrierten Partnerschaft sei jenem der Ehe zu ähnlich, meinen die Bischöfe. Das neue Gesetz schütze daher die Ehe nicht genügend. In der vorliegenden Form sei das Gesetz "gesellschaftspolitisch falsch und unklug", betonte Weihbischof Peter Henrici in der Churer "Südostschweiz". Die Liebe zu regeln sei keine Staatsaufgabe. Die Ehe werde vom Staat nicht wegen der Liebe privilegiert, sondern weil es um die Familie gehe, um den "Zeugungszweck" der Ehe. Nach Feststellung Henricis ist in der Schweiz der Schutz von Ehe und Familie ohnehin unzulänglich. Wenn man jetzt noch gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Ehe annähere, sei dieser Schutz noch weniger gewährleistet. In der Tat scheint der "Zeugungszweck" der Ehe in Westeuropa stark an Popularität eingebüsst zu haben, wie Zahlen im nahen Ausland belegen. Wie viele Kinder möchten Sie gerne haben? Dies fragten die Autoren einer vor wenigen Tagen in Berlin publizierten Studie des staatlichen Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Sie zeigt, dass der durchschnittliche Kinderwunsch in Deutschland von früher 2,0 pro Familie auf 1,7 gefallen ist. Vor allem die Zahl junger Menschen, die überhaupt keine Kinder wollen, ist deutlich gestiegen. Sie ist seit 1992 bei den Frauen von 10 auf 15 Prozent gestiegen, bei den Männern noch stärker von 12 auf 26 Prozent. Es ist nicht anzunehmen, dass eine ähnliche Studie in der Schweiz zu wesentlich anderen Ergebnissen kommen würde. Denn nach dem "Babyboom" bis Ende der 1960er Jahre erfolgte auch in unserem Land ein historisch einmaliger Geburtenrückgang bis weit unter die für den Erhalt des Bevölkerungsstandes nötige Zahl. Im statistischen Durchschnitt bringen derzeit 100 Frauen im Laufe ihres Lebens 139 Kinder zu Welt. Zum Generationenerhalt wären jedoch 210 Geburten notwendig, ein Wert, der laut Statistik letztmals 1970 erreicht worden ist. Auch die Zahl der Eheschliessungen ist in der Schweiz deutlich zurückgegangen. Im Jahr 1970 traten laut Statistik 15 von 1.000 Einwohnern neu in den Ehestand, 2003 taten dies noch 11 von 1.000 Einwohnern der Schweiz. Wie kann der Staat Heiraten und Kinderkriegen fördern? Seit langem bemüht sich die Politik um materielle und rechtliche Massnahmen des Staates zu diesem Zweck. Doch dies genügt offensichtlich nicht: Männer und Frauen im entsprechenden Alter müssen zuerst motiviert werden, überhaupt Kinder haben zu wollen. Es ist eine Frage der Ideale, die allein mit materiellen und rechtlichen Verbesserungen nur unzulänglich angegangen werden kann. In St. Gallen ortet der katholische Ehe- und Familienseelsorger Niklaus Knecht, langjähriger Leiter der diözesanen Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau als wichtigen "Problem- und Stress-Ort" der Partnerschaften. "Partnerschaft ist ein Seismograph für Defizite in der Gesellschaft", betont Niklaus Knecht. Es gebe mehr Männer, als man gemeinhin denke, die Probleme mit dem veränderten Rollenverständnis der Schweizer Frauen hätten. Der Rollenwandel habe namentlich auch auf dem Gebiet der Sexualität eine grosse Verunsicherung ausgelöst. Dies passt zu einer Feststellung, die zu Beginn des Jahres in einem Bericht der "Weltwoche" zu lesen war: Fast jeder dritte Schweizer Mann, der sich vermählt, heiratet eine Ausländerin - meist eine Frau aus fernen Ländern, wo noch die traditionelle Rollenteilung von Mann und Frau dominiert. Bei stark zunehmender Tendenz: Vor acht Jahren heiratete erst jeder vierte Schweizer eine Ausländerin, vor zwölf Jahren erst jeder fünfte. Damit die Institution der Ehe in unserem Kulturkreis eine Zukunft habe, sei jedoch eine ausgeglichene Partnerschaft eine absolute Notwendigkeit, erinnert Knecht. Es gehe aber nicht nur um Gleichberechtigung, sondern auch um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit der Frau. Knecht: "Was die Möglichkeit der neuen Rollenverteilung angeht - etwa Teilzeitarbeit für Männer auch in qualifizierten Berufen -, so stehen wir in der Schweiz noch am Anfang." Arbeit, Kinder, Partnerschaft und persönliche Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, sei für viele das grösste Problemfeld, berichtet der Eheberater. Denn in jedem Lebensabschnitt müsse man sich - als Mann oder als Frau - in einem der vier genannten Felder zurücknehmen. Frauen und Männer könnten heute ihr Selbstwertgefühl sowohl über die Familie wie über die Arbeit definieren. Das gebe dem Muttersein einen anderen Stellenwert, nehme ihm die frühere Ausschliesslichkeit. Häufig würden Kinder für die Partnerschaft von Mann und Frau als Belastung empfunden, bedauert Knecht. "Dadurch, dass die Kinder immer rarer werden und die gesamthaft gesehen kinderfeindlich agierende Gesellschaft darauf drängt, dass diese Kinder gelingen, entsteht ein ungeheurer Druck auf die Eltern." Behinderte, kranke oder psychisch angeschlagene Kinder hätten in vielen Fällen negative Auswirkungen auf die Ehe. Die Hälfte der Eltern mit Totgeburten oder Frühgeburten, die sterben, seien innert zwei Jahren geschieden. Verhängnisvoll sei auch der hohe Stellenwert der Statussymbole: "Man ist schnell nicht mehr bei den Leuten, wenn man nicht die nötigen materiellen Attribute besitzt." Die Gesellschaft sei materialistischer geworden. Wenn er Eltern frage, was sie bei den Kindern gefördert wissen und welche Werte sie weitergeben wollten, könne man dies erkennen. Schädlich wirkt sich laut Niklaus Knecht auch die "Überidealisierung von Beziehungen" aus. Ehe und Familie würden überfrachtet mit überidealen Erwartungen, die man nicht erfüllen könne. Es sei der Perfektionismus, der die Beziehungen am gründlichsten zerstöre. Als Gegenmittel sei die religiöse Dimension der Ehe sehr wichtig. Sie bedeute, dass der Partner, die Partnerin "mir nicht Gott ersetzen, mir nicht alles sein muss". Man dürfe als Partner, als Partnerin auch Fehler, Grenzen und Unzulänglichkeiten haben. Mehr zum Thema siehe folgende Magazinartikel: Mit falschen Erwartungen in die Ehe Und wenn meine Ehe trotzdem scheitert? Die Vorteile der Ehe: «Es war wie im Märchen, nur noch viel, viel schöner» „Partnerschaftgesetzt könnte Situation noch verschlimmern“
Kinder unbeliebt
Rollenverteilung problembeladen
Sich zurücknehmen für andere
Materialistisch denkende Gesellschaft
Ehe – Chance und Aufgabe
Datum: 30.05.2005
Quelle: KIPA