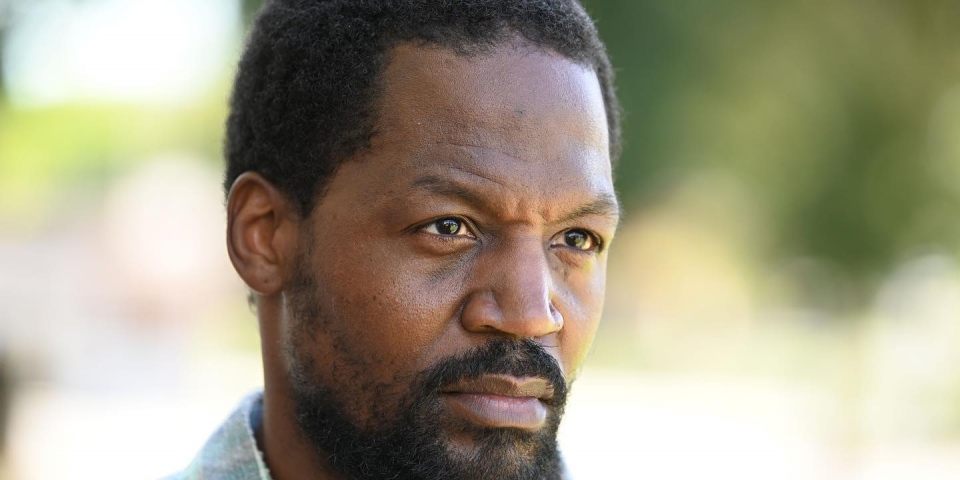"Illuminati" – grosses Kino, kurze Geschichte
Immerhin wartet der Streifen unter der Regie von Ron Howard wieder mit Star-Besetzung auf. Allen voran Tom Hanks, der wie schon im "Da Vinci Code" die Rolle der Hauptfigur Robert Langdon übernommen hat.
Explosive Verschwörung
In "Illuminati" ist der Professor für Kunstgeschichte einer explosiven Verschwörung um den Papstthron auf der Spur. Eine geheimnisvolle Organisation droht damit, die zur Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts im Vatikan versammelten Kardinäle zu töten und den Hauptsitz der katholischen Kirche in die Luft zu sprengen. Langdon nimmt die Spur der Verschwörer auf, die sich selbst Illuminaten nennen, und folgt ihnen in einer rasanten Jagd quer durch Rom auf dem "Pfad der Erleuchtung". Symbole und versteckte Hinweise in Kirchen und anderen altehrwürdigen Bauwerken bringen den Wissenschaftler der Lösung näher. Doch bis zum Finale scheinen die Verbrecher immer einen Schritt voraus zu sein.Der bisweilen abenteuerlich anmutende Mix aus Kirche, Krimi und Kunstgeschichte bedient nach Ansicht des deutschen Trendforschers Eike Wenzel das Bedürfnis der modernen Gesellschaft nach einer "Wiederverzauberung der Welt". Angesichts der vielfach als komplex und bedrohlich empfundenen Lage in Politik, Wirtschaft und Umwelt steige die Sehnsucht nach einer "Erleuchtung in dunkler Zeit", wie der Experte des Zukunftsinstituts im hessischen Kelkheim in Anspielung auf den Filmtitel formuliert. Dass bei dieser Form der Wirklichkeitsflucht die historischen Tatsachen gelegentlich auf der Strecke bleiben, tut dem Erfolg von Buch und Film offenbar keinen Abbruch.
Mythos
"Recht trivial" findet die Grazer Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl den Brownschen Ansatz, den Illuminaten eine Jahrhunderte währende Geschichte anzudichten, die sie de facto nie gehabt hätten. Damit setze der Schriftsteller letzten Endes eine Tradition fort, die bereits zu Hochzeiten der alternativen religiösen Bewegungen im ausgehenden 18. Jahrhundert gepflegt wurde. Wie die "Erleuchteten" bemühten auch Freimaurer und Rosenkreuzer eine Nähe zu antiken oder mittelalterlichen Strömungen, deuteten sie um und verpassten ihnen einen mythischen Anstrich.Tatsächlich aber bestand die am 1. Mai 1776 von dem Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt im bayerischen Ingolstadt gegründete Gruppe der Illuminaten nur gute zehn Jahre und zählte nie mehr als 2.000 Mitglieder. Ihr erklärtes Ziel war die Befreiung von weltlicher und geistlicher Herrschaft durch die Ideale der Aufklärung. Als Symbol wählte die Gruppe daher die Eule der römischen Weisheits-Göttin Minerva.
Gegensatz zwischen Kirche und Wissenschaft
Eine "nette akademische Vereinigung" geprägt von mehr oder weniger bekannten Gelehrten und Beamten seien die Illuminaten gewesen, fasst Heimerl zusammen. Und eigentlich wenig geeignet, um den von Brown und anderen immer wieder thematisierten Gegensatz zwischen Kirche und Wissenschaft zu illustrieren.Wenn da nicht die Französischen Revolution 1789 gewesen wäre. In deren Gefolge erfuhr der kurzlebige Akademiker-Bund sozusagen posthum eine eigentümliche Aufwertung. Einige Zeitgenossen deuteten das epochale Ereignis nämlich als Verschwörung von kirchen- und adelsfeindlichen Freimaurern.
Historische "Verschwörungs-Vorbilder"
Tatsächlich gab es in dieser Zeit auch eine Freimaurer-Loge namens "Les Illuminés", die jedoch für den weiteren Verlauf der Geschichte keine besondere Rolle spielte. Im 19. Jahrhundert kursierende Theorien machten vor diesem Hintergrund aus den Illuminaten ein international agierendes Bündnis, das im Verborgenen an einer neue Weltordnung arbeitet. So betrachtet, orientieren sich Dan Browns Roman und der darauf basierenden Film dann doch an historischen "Verschwörungs-Vorbildern".Kommentar
Auf Schnitzeljagd nach Antimaterie
von Christoph Scholz / KipaDurchaus gekonnt stellt Howard zu Beginn die Welt von Religion und Mystik jener der Technik und Wissenschaft gegenüber. Während in Rom die Kardinäle nach dem plötzlichen Tod des Papstes zum Konklave zusammenkommen, wird im Europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf erstmals "Antimaterie" produziert. Und wie es der Teufel will, werden nicht nur gleich die vier aussichtsreichsten Kardinäle bei der Papstwahl entführt, sondern auch die frisch gewonnene "Antimaterie" aus Genf. An einen geheimen Ort im Vatikan verbracht, soll sie innerhalb von 24 Stunden den Kirchenstaat und halb Rom in einem Feuerball verschlingen. Den Kardinälen geht es schon vorher an den Kragen.
Symbol-Schnitzeljagd
Damit ist das Grundmuster für eine spektakuläre Symbol-Schnitzeljagd gegeben. Langdon, einer Art Indiana Jones der Kunstgeschichte, gesellt sich dabei die Cern-Spezialistin für Antimaterie, Vittoria Vetra (Ayelet Zurer), bei. Doch bevor es auf die Fährtensuche geht, bombardieren beide den Zuschauer zunächst mit schier endlosen Informationen über Physik und Symbolik, so dass einem zwischen Dichtung und Wahrheit ganz schwindlig wird. Natürlich spielen auch Zahlen eine Rolle. Die vier Kardinäle stehen nicht nur für die vier Säulen der Kirche. Sie finden ihre Entsprechung in den vier Elementen, und an diesen sollen sie zugrunde gehen - falls Langdon nicht schneller kombiniert, als der Killer tötet.Kreuz und quer durch Rom
Der Havard-Professor steht dabei trotz assoziativer Hochseilakrobatik für die kritische Vernunft. Ob in Galileos Werken oder in Schwertern und Pfeilen von Engelstatuen: überall wittert er die rechten Zeichen. So geht es in schwarzen Limousinen dem "Pfad der Erleuchtung" nach, kreuz und quer durch die römische Altstadt: vom Pantheon nach Santa Maria del Popolo und zurück in den Vatikan, dann wieder nach Santa Maria della Vittoria und zum Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona, stets auf der Suche nach den Papstkandidaten. Doch der eine erstickt an Erde, der andere verbrennt im Kirchenschiff, der dritte stirbt mit durchlöcherter Lunge. Nur den vierten kann der rasende Professor vor dem Ertrinken im Bernini-Brunnen retten.Sehr, sehr lang
Das ist alles schnell geschnitten und rasant verfilmt: Durch 700-Buchseiten hastet der Film in zwei Kinostunden. Dennoch werden sie sehr, sehr lang - nicht nur wegen der immer abstruseren Deutungen und Motive. Die Kardinäle sind alle nett und ziemlich betulich. Armin Müller-Stahl gibt einmal mehr den Weisen. Diesmal nicht als Konsul Buddenbrook sondern als Kardinal, der das Konklave leitet und den selbst Antimaterie nicht aus der Sixtina treiben kann.Am Ende bittet er altersmilde um Nachsicht, dass es eben überall menschelt, auch in den heiligen Hallen. Trotzdem bleibt der Film eigentümlich unterkühlt und oberflächlich, er verweilt bei niemandem und nirgendwo. Hans Zimmers dicker Klangteppich überdeckt vor allem logische wie dramaturgische Untiefen. Sogar beim Showdown mit einer galaktischen Explosion über dem Petersdom springt kein Funke über.
Datum: 11.05.2009
Quelle: Kipa