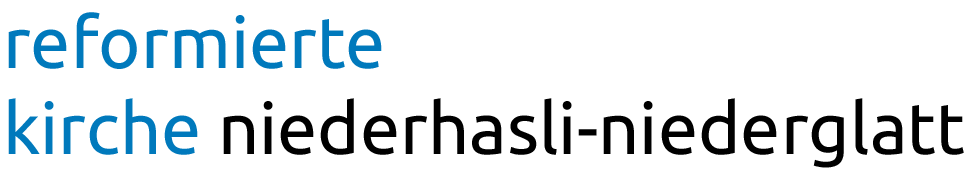Da gute Antworten für den Gesundheitsbereich nur dann zu finden sind, wenn alle Beteiligten eingebunden sind, befanden sich unter den Referenten der EU-Kommissar für Gesundheit und Konsumentenschutz, David Byrne, genauso wie Konsumentenschützer, hochrangige Gesundheitspolitiker wie Heidi Hautala und Herbert Haupt, führende Wissenschaftler genauso wie Vertreter von Ärzte- oder Apothekerkammern. Das diesjährige EHFG-Schwerpunktthema lautete "Gemeinsame Herausforderung an Gesundheit und Pflege". Die Referenten beleuchteten aus verschiedenen Blickwinkeln die aktuellen Umbrüche in den europäischen Gesundheitssystemen wie z.B. "Patiententourismus" in Theorie und Praxis. Ende Juni des Jahres hatte der Rat der EU-Gesundheitsminister in Luxemburg beschlossen, die Mobilität der Patienten zukünftig stärker im europäischen Recht zu verankern. Damit soll der Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten im Ausland erleichtert werden. In Perspektive sollten spezialisierten Zentren für besondere Eingriffe geschaffen werden. Wartezeiten auf eine Behandlung könnten durch die Nutzung freier Kapazitäten im Ausland verkürzt werden. Es besteht weiters die Chance auf grenzüberschreitende Gesundheitsbetreuung in Grenzgebieten und eine verbesserte Gesundheitsbetreuung für Menschen, die für längere Zeit in anderen EU-Mitgliedsstaaten leben. Dr. Franz Terwey, Direktor der European Social Insurance Partners, einer Dachorganisation von 31 europäischen Krankenkassen, begrüsst diese Entwicklung: Sie würde nicht nur die Professionalisierung von Krankenhäusern vorantreiben, sondern auch Kosten sparen. Heidi Hautala, finnische Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Präsidentin der Untergruppe Gesundheit, bezeichnete in ihre Schlusswort eine europaweite Harmonisierung des gesetzlichen Rahmens für Gesundheit als die Herausforderung Intensiv berieten die EHFG-Experten auch das Thema "Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Qualität in der Gesundheitsversorgung". Für eine Qualitätssteigerung der europäischen Gesundheitssysteme bedürfe es neuer Managementkonzepten und eines neuen "Mix" zwischen öffentlichen und staatlichen Anteilen im Gesundheitswesen. Es ginge auch darum, neue Informationssysteme einzuführen, die den Patienten mit einbeziehen. Dr. Ladislav Mravec vom General Health Insurance Fund, Tschechien, stellte in dem Zusammenhang das iZIP-Projekt vor. Das iZIP ist eine medizinische Datenbank für Versicherte, in der die Krankheitsgeschichte des Patienten dokumentiert wird. Damit wird transparent, welche Behandlungen der Patient schon hinter sich hat. Erfolglose Therapien werden nicht wiederholt. Kein Doppelgemoppel also, das den Organismus wie die Finanzen des Gesundheitssystems unnötig belastet. Eingetragen werden die Befunde vom jeweiligen Arzt. Doch nur der Patient kann auf die Daten zugreifen und entscheiden, welcher Arzt oder welche Institution sich weiter einloggen darf. Eines der Diskussionsforen nahm sich eines gesundheitspolitischen Dauerbrenners an: Reiche leben länger und gesünder als Menschen mit geringerem Einkommen. In sozialstaatlichen Entwicklungsländern wie Mexiko zeichne sich das krasser ab, sagte Professor Robert Beaglehole, zuständig für Gesundheitsvorsorge bei der WHO. Eine Person aus der Unterschicht lebt statistisch gesehen 13 Jahre weniger als eine aus der Oberschicht. In Europa geht die Schere zwischen Reich und Arm zwar nicht gar so weit auseinander, doch sterben auch in England Arbeiter durchschnittlich um sechs Jahre früher als Akademiker. Eine gute Volksgesundheit basiere auf politischen Entscheidungen, unterstrich Professor Richard Wilkinson von der Universität Nottingham. Dr. Hans Stein, Mitglied des Gesundheitsausschusses der EU-Kommission, forderte in diesem Zusammenhang: "Gesundheit muss politisches Gewicht erlangen. Die EU darf nicht bloss für Wirtschaftsinteressen gut sein, sondern für Bürgerinnen und Bürger." Rinderwahnsinn und die Creutzfeld-Jacob-Krankheit, die Maul- und Klauenseuche und Nitrofen im Putenfleisch und im Getreide. Die Lebensmittelskandale der letzten Jahre haben die Europäer für die Qualität ihrer Nahrungsmittel sensibilisiert. Über ihr alltägliches Essverhalten scheinen sich viele allerdings kaum Gedanken zu machen. Tatsächlich gebe es aber hundert Mal mehr Tote durch unausgewogene Ernährung als durch vergiftete Nahrung, bestätigte Camilla Sandvik von der Universität Oslo, die sich bis vor kurzem bei der Europäischen Kommission mit dem Thema befasst hat. Karen Lock von der London School of Hygiene and Tropical Medicine – sie arbeitet derzeit für die WHO an einer Studie über die globale Belastung von ernährungsbedingten Krankheiten – stellte fest: "Der mangelnde Verzehr von Obst und Gemüse hat einen viel grösseren Einfluss auf die Gesundheit als jeder von uns gedacht hätte." Auf dem Ernährungssektor ist auch ein regelrechter Informationskrieg ausgebrochen zwischen Lebensmittelkonzernen und Gesundheitsorganisationen, zwischen Werbefirmen und Konsumentenschützern. Trendige Mogelbegriffe wie "cholesterinfreies Rapsöl" oder "fettfreier Honig" tragen dabei nicht gerade zur Transparenz bei. Für Anna Jung vom European Food Information Council müsse ein offener und ausgewogener Dialog zwischen den Interessensgruppen aufgebaut werden. Als Beispiel dafür nannte Ernährungsforscherin Gill Fine die Supermarktkette Sainsbury, die Konsumentenvertreter in den Entwicklungsprozess von Produkten mit einbezieht. Anlässlich des Starts des 6. EU-Forschungsrahmenprogrammes, mit dem ein europäisches Forschungsgebiet geschaffen werden soll, nahmen EHFG-Experten auch die "Public Health Research for European Community Policies" unter die Lupe. Forschung sei eine der entscheidendsten Säulen eines funktionierenden Gesundheitssystems, betonte Mia Defever von der Katholischen Universität Leuven, Belgien. Die gesundheitspolitische Diskussion sollte von empirische Ergebnissen gesteuert sein, und nicht von ideologisch gefärbten Annahmen. Wichtig, wenn auch schwierig, sei es, den aktuellen Wissensstand an die politischen Entscheidungsträger zu vermitteln. Staatssekretät Reinhard Waneck mahnte zu zeitgerechten, vorausschauenden Planungen im Gesundheitsbereich. "Zukunft passiert nicht, sondern wird in der Gegenwart gemacht." Innovationen seien auf zukünftige gesamtpolitische Entscheidungen abzustimmen. Im EU-Kontext betreffe dies jene neuen Bewerberstaaten, deren Gesundheitssysteme nicht auf dem europäischen Standard seien. Sich im osteuropäischen Raum epidemisch ausbreitende Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, AIDS und Malaria könnten auch zu Gefährdungen für mitteleuropäischen Patienten und Gesundheitssysteme werden. Deshalb müsse schon jetzt in die Angleichung an das internationale Niveau investiert werden, um viel höhere Kosten in Zukunft zu vermeiden.Mit dem Gipsbein auf Reisen…
Phantombild "Qualität"
Lieber reich und gesund als arm und krank…
Vom Falschen zu viel
Cholesterin- und informationsfrei
Wie man Wissen schafft
Osterweiterung – Chancen und Probleme
Datum: 02.10.2002
Quelle: pte online